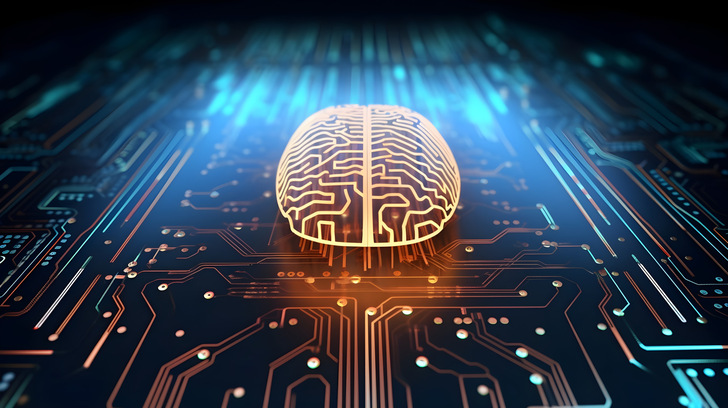Sechs von zehn Befragten sind überzeugt, dass Kenntnisse in Künstlicher Intelligenz künftig entscheidend für die Beschäftigungsfähigkeit sein werden. Sie sind ebenso der Meinung, dass KI und Data Science zu den gefragtesten Bereichen der nächsten fünf Jahre zählen werden. Diese Entwicklung bringt allerdings auch Unsicherheiten mit sich: Ein Drittel der Befragten befürchtet, dass der eigene Job durch KI ersetzt werden könnte. Die Dimension dieses Wandels wird besonders durch eine weitere Erkenntnis deutlich: Sieben von zehn Befragten gehen davon aus, dass künftige Generationen Berufe ausüben werden, die heute noch gar nicht existieren. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer flexiblen und zukunftsorientierten Kompetenzentwicklung.
Klassische Bildungswege reichen nicht mehr aus
Die traditionelle Vorstellung eines einmaligen Bildungswegs hat ausgedient. Acht von zehn Menschen sehen die Notwendigkeit, ihr Wissen kontinuierlich zu erweitern. Besonders bemerkenswert: 38 % der Befragten geben an, dass die Ausbildung, die sie vor dem Einstieg in den Arbeitsmarkt erhalten haben, für ihre heutige Tätigkeit nicht hilfreich war. Fast vier von zehn Befragten würden sich heute nicht noch einmal für dasselbe Studienfach entscheiden.
Verantwortung für Weiterbildung ist umstritten
Die Frage, wer für die kontinuierliche Weiterbildung verantwortlich sein sollte, spaltet die Befragten. 43 % sehen die Unternehmen in der Verantwortung, ihre Mitarbeitenden weiterzubilden. 39 % halten die Angebote des öffentlichen Sektors für lebenslanges Lernen für unzureichend, während 25 % diese Aufgabe dennoch beim öffentlichen Sektor sehen. 29 % vertreten die Auffassung, dass die Verantwortung für lebenslanges Lernen bei jedem selbst liegen sollte.
Soft Skills gewinnen an Bedeutung
Trotz der Fokussierung auf technische Kompetenzen wie KI zeigt die Studie: Fast die Hälfte der Befragten (45 %) hält Soft Skills wie Kommunikation, Führung und Teamwork für wichtiger als technische Qualifikationen. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit eines ausgewogenen Kompetenzportfolios.
Digitale Lernplattformen noch nicht etabliert
Obwohl sich digitale Lernplattformen als alternative Weiterbildungsmöglichkeit entwickeln, kennen 89 % der Befragten diese Tools noch nicht. Dennoch zeigen sich 60 % bereit, sie zu nutzen. 36 % bevorzugen hybrides Lernen, während 31 % öffentliche Universitäten als Anbieter für ihre Weiterbildung wählen würden.
Deutsche Skepsis gegenüber digitalen Lernformaten
In Deutschland liegt die Zustimmung zu lebenslangem Lernen mit 78 % leicht unter dem globalen Durchschnitt von 81 %. Besonders auffällig: Nur 36 % der deutschen Teilnehmer bewerten digitale Lernplattformen als positiv – Deutschland belegt damit den vorletzten Platz im internationalen Vergleich. 47 % der Deutschen sehen Unternehmen in der Verantwortung für Weiterbildungsangebote, weniger als der europäische Durchschnitt von 50 %.
Fazit: Weiterbildung als Investition in die Zukunft
Die Studie macht deutlich, dass lebenslanges Lernen kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit geworden ist. Besonders KI-Kompetenzen werden zu einem entscheidenden Faktor für die Beschäftigungsfähigkeit. Gleichzeitig zeigt sich, dass Deutschland bei der Akzeptanz digitaler Lernformate noch Nachholbedarf hat. Die Herausforderung liegt darin, nicht nur neue Bildungsformate zu entwickeln, sondern auch Vertrauen und Qualität in der digitalen Weiterbildung zu stärken.
Der vollständige „Tomorrow's Skills Report" steht auf der Website von Santander in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung.