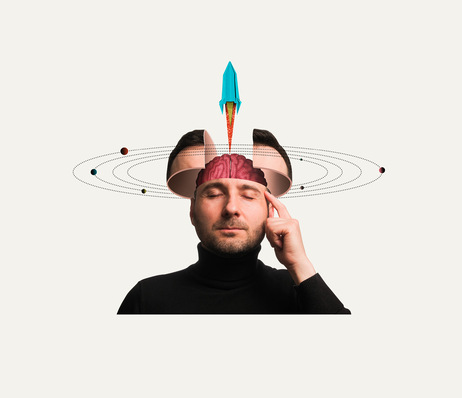„Übergänge“, so lautet der Kurztitel Ihres aktuellen, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Forschungsprojekts: „Kompromissbildung und deren Konsequenzen – Pfadabhängigkeiten zwischen Berufsfindung, Bildungsentscheidungen und Ausbildungsverläufen". Wie definieren Sie den Begriff der „Übergänge“ in diesem Kontext?
Der Begriff bezeichnet einen Forschungsbereich, der sich mit dem Übergang zwischen Schule und Arbeit beschäftigt. Dieser Übergang ist international sehr unterschiedlich. In nicht wenigen Ländern gehen beispielsweise viele Jugendliche von der Schule direkt in Arbeit über. Demgegenüber bildet bei uns in Deutschland die berufliche Ausbildung den Standard. Der Prozess des Übergangs beginnt in unserer Definition nicht erst mit dem Schulabschluss, sondern schon wesentlich früher. Wir fragen nach den Wunschberufen der Jugendlichen in dieser frühen Phase und verfolgen mit, wie sie sich anschließend weiterentwickeln. „Übergang“ bedeutet für uns also die gesamte Phase der Berufsfindung inklusive Berufsberatung bis zur Einmündung in einen ersten Ausbildungsberuf.
Was verstehen Sie unter „Pfadabhängigkeiten“?
Pfadabhängigkeiten bedeuten, dass mir nicht mehr alle Optionen zur Verfügung stehen, nachdem ich einen bestimmten Weg eingeschlagen habe. Eine frühere Entscheidung bedingt immer eine spätere. Was wir damit meinen, sind die Konsequenzen, die daraus entstehen, dass viele Jugendliche ein bestimmtes Berufsspektrum schon sehr früh ins Auge fassen und viele andere Bereiche ausschließen. Teilweise geschieht dies bereits in der Kindheit und ganz unbewusst. Vieles wird von vornherein nicht in Betracht gezogen, weil es nicht zu den eigenen Interessen passt, zum Geschlecht oder zum Status der Eltern und ihrer Umgebung. Dadurch schränken sich die Jugendlichen sehr stark ein und so entstehen Pfadabhängigkeiten, lange bevor überhaupt die Frage auftaucht: „Auf welchen Ausbildungsplatz soll ich mich bewerben?"
In Ihrem aktuellen Forschungsprojekt „Übergänge“ gehen Sie – unter anderem – folgender Leitfrage nach: Wie passen Jugendliche vor Ende der Schulzeit ihre Berufswünsche und Bildungsaspirationen an die Erwartungen ihrer Umwelt und die Realitäten des Ausbildungsmarktes an? Gibt es hierzu bereits Ergebnisse, von denen Sie uns berichten können?
Ja, die gibt es! Wir haben für jeden Jugendlichen in den NEPS-Daten des Nationalen Bildungspanel seinen realistischen Wunschberuf hinterlegt. Dazu hatten wir die Jugendlichen noch in der Schule gefragt: Was glaubst du, kannst du realistisch machen? Die hier angegebenen Wunschberufe haben wir anschließend mit dem ersten erreichten Ausbildungsberuf der Jugendlichen verglichen. Dabei wurden schulische und berufliche Ausbildungen gleichermaßen in die Betrachtung mit einbezogen. Für jeden Beruf in Deutschland haben wir strukturelle Merkmale zu unseren Da ten hinzugefügt, z. B. den Durchschnittslohn, das durchschnittliche Qualifikationsniveau der Arbeitnehmer/innen, das Berufsprestige, der Anteil von Beschäftigten mit atypischen Arbeitszeiten, der Anteil von Großbetrieben, das Arbeitslosigkeitsrisiko der Beschäftigten. Und dann haben wir die Wunschberufe der Jugendlichen mit ihren Ausbildungsberufen anhand dieser Merkmale verglichen.
So konnten wir analysieren, wie viele Jugendliche genau den Beruf erreicht haben, den sie sich gewünscht haben. Unser Ergebnis: Das sind sehr wenige! Gerade einmal 16 Prozent von denen, die überhaupt in eine Ausbildung gegangen sind. Knapp ein Drittel (31 %) hatte noch keinen Wunschberuf. Der große Rest (52 %) musste Kompromisse machen und sich einen anderen Ausbildungsberuf suchen als den ursprünglichen Wunschberuf. Anschließend haben wir untersucht, welche Muster sich in den Kompromissen zeigen, die die Jugendlichen in puncto Sicherheit, Status und Prestige gemacht haben. Und tatsächlich haben wir vier eindeutige Muster gefunden:
- Eine erste Gruppe von Jugendlichen konnte Berufe erreichen, die ihren Wunschberufen sehr ähnlich waren.
- Bei einer zweiten Gruppe hatten sich vor allem die Arbeitsbedingungen im Vergleich zum Wunschberuf verschlechtert. Diese Jugendlichen mussten dann beispielsweise Nacht- oder Wochenendarbeit leisten.
- Eine dritte Gruppe hatte sich in allen Bereichen stark verschlechtert: Arbeitsbedingungen, Einkommen, Lohn.
- Schließlich gab es noch eine vierte Gruppe, die sich verbessert hatte. Das war auch für uns sehr spannend, denn damit hatten wir nicht gerechnet!
Vor allem die Höhe der Aspirationen war ausschlaggebend dafür, wer in welcher Gruppe gelandet ist. Die Jugendlichen, die besonders hohe Erwartungen hatten, mussten diese oftmals nach unten anpassen. Das liegt zwar im Grunde auf der Hand, ist aber dennoch wichtig, denn die Höhe der Aspirationen steht in vielen Fällen in einem engen Zusammenhang mit der sozialen Herkunft. So haben etwa Jugendliche mit Migrationshintergrund häufig hohe Aspirationen.
Was auch sehr stark strukturierend wirkt, sind Schulabschlüsse und Noten. Je besser ihre Bildung ist, desto weniger Kompromisse mussten die Jugendlichen machen und desto häufiger haben sie sogar eine Verbesserung erreicht. Ein Ergebnis, mit dem wir so nicht gerechnet hatten war, dass die soziale Herkunft im Grunde keine Auswirkungen darauf hatte, in welcher Gruppe sich die Jugendlichen wiedergefunden haben. Die eigene Bildung war also ausschlaggebend, nicht die der Eltern. Eine Ausnahme bilden hierbei die Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Bei ihnen haben wir festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit, sich zu verschlechtern, höher ist als bei anderen Jugendlichen. Das liegt aber nicht nur an ihren Aspirationen. Die sind tatsächlich vergleichsweise hoch, aber auch unabhängig davon tun sich Jugendliche mit Migrationshintergrund offenbar schwerer, einen Ausbildungsplatz in ihrem Wunschberuf zu finden.
Können Sie aus den Ergebnissen Ihrer Studie und aus Ihren allgemeinen Erfahrungen als Wissenschaftlerin Empfehlungen für praktische Anwender/- innen im Beruf und in der beruflichen Bildung ableiten?
Eine Empfehlung kann ich tatsächlich geben: Es ist wichtig und kann sehr hilfreich sein, die eigenen Stereotype zu hinterfragen! Wir stellen immer wieder fest, wie sehr sich in den Prozessen vom Berufswunsch bis zur Ausbildung klischeehafte Geschlechterbilder oder Vorurteile verfestigen, die ihren Ursprung im sozialen Umfeld haben. Das hat auch viel mit Beratungsprozessen zu tun. Wir haben zumindest indirekte Hinweise, dass sich durch Beratung vieles verstärkt. Das heißt: Jugendliche mit Berufswünschen, die eher untypisch für ihre soziodemografische Gruppe sind (z. B. Männer in Frauenberufen), haben es schwerer. Sie werden dann mit größerer Häufigkeit in die Berufe gedrängt, die für ihre Gruppe eigentlich typisch sind. Daher sollten wir daran arbeiten, die eigenen Vorurteile – dahingehend, welche Personen besonders gut auf welche Berufe passen – zu hinterfragen. Wir sollten außerdem versuchen, das Spektrum des Nachdenkens hierüber auch für Jugendliche zu erweitern und sie ermutigen, nach bislang wenig beachteten Möglichkeiten Ausschau zu halten. Dafür entsprechende Werkzeuge zu schaffen, sehe ich als eine große Aufgabe für die Zukunft. Gerade im Hinblick auf das Geschlecht und die Berufe, die dringend besetzt werden müssen.
Wie können wir Berufe, die an einem Mangel an Auszubildenden leiden, attraktiver machen? Auch für jemanden, der als Bewerber/in viel zu bieten und entsprechend gute Möglichkeiten hat?
Ich denke, dass es helfen könnte, aufzuzeigen, welche Ausbildungsberufe große Spielräume für Autonomie bieten. Das ist in vielen Handwerksberufen der Fall. Auch bei einem Bäcker oder einer Metzgerin. Als Meister/in kann man im Handwerk sehr viel erreichen, gerade in der Selbstständigkeit. Das ist tatsächlich sogar eine gute Alternative zum Studium. Dieser Faktor wird von vielen Jugendlichen unterschätzt und zu wenig in ihre Überlegungen bei der Berufswahl mit einbezogen. Wir haben dazu keine guten Daten, aber ich gehe davon aus, dass viele Jugendliche unzureichende Vorstellungen davon haben, welche Einkommensmöglichkeiten es in Handwerksberufen gibt. Gerade, wenn ihre Eltern nicht in Handwerksberufen arbeiten. Hier müssten die Jugendlichen meines Erachtens besser informiert werden. Es könnte außerdem, gerade für kleinere Ausbildungsbetriebe, mehr Unterstützung oder eine Art Coaching dahingehend geben, wie sie Jugendliche, die gut zu ihnen passen würden, wirklich finden und für sich gewinnen könnten.
Das Nationale Bildungspanel
Das Nationale Bildungspanel (National Educational Panel Study, NEPS) besteht aus sechs großen und langfristig angelegten Teilstudien, die am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi) in Bamberg beheimatet sind. Ziel des Nationalen Bildungspanels ist es, Längsschnittdaten zu Kompetenzentwicklungen, Bildungsprozessen, Bildungsentscheidungen und Bildungsrenditen über die gesamte Lebensspanne zu erheben. Das Forschungsdatenzentrum des LIfBi bereitet die Daten des Nationalen Bildungspanels auf und stellt diese der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Verfügung.
Das ganze Interview mit Prof. Dr. Kleinert lesen Sie auf: www.worldskillsgermany.com/de/blog/2020/12/05/mehr-freiheit-fuer-berufswuensche
Mehr Informationen zur Studie von Prof. Dr. Kleinert finden Sie unter: www.lifbi.de/Übergänge

Prof. Dr. Corinna Kleinert
Professorin für Soziologie an der Universität
Bamberg und Abteilungsleiterin
am Leibnitz-Institut für Bildungsverläufe