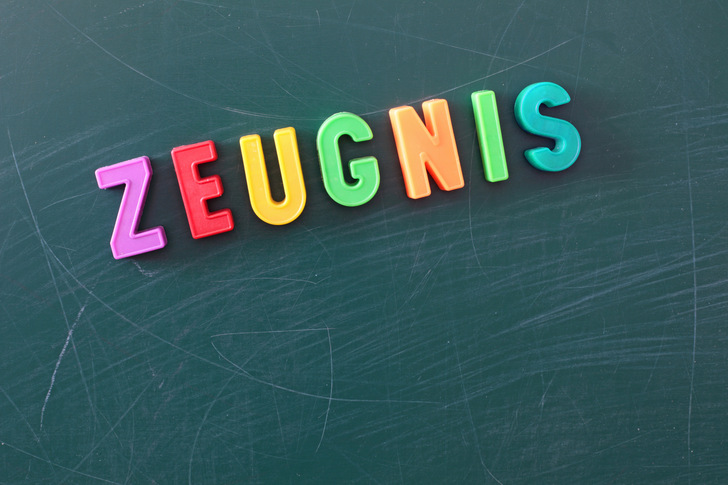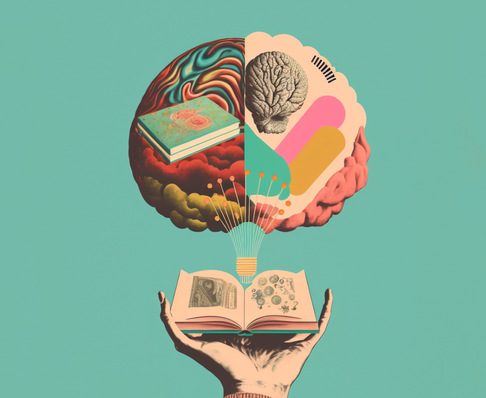Pünktlich zur Zeugniszeit haben die Forscherinnen Elena Ziege vom BiB und Ariel Kalil eine Studie vorgelegt, die Konsequenzen für die Gestaltung von Schulrückmeldungen haben könnte. Die Untersuchung basiert auf bundesweiten Daten des Nationalen Bildungspanels (NEPS) und konzentriert sich auf das erste Grundschuljahr.
Eltern überschätzen systematisch die Leistungen ihrer Kinder
Ein zentraler Befund der Studie ist die weit verbreitete Selbstüberschätzung bei der elterlichen Leistungseinschätzung. Die meisten Eltern bewerten die schulischen Fähigkeiten ihrer Kinder in Deutsch, Mathematik und Naturwissenschaften höher, als sie tatsächlich sind. Besonders ausgeprägt ist diese Fehleinschätzung in bildungsfernen und zugewanderten Familien.
„Diese Fehleinschätzung kann dazu führen, dass Kinder von Eltern nicht ausreichend gefördert werden“, erklärt Elena Ziege, Bildungsforscherin am BiB. Die mangelnde Übereinstimmung zwischen elterlicher Wahrnehmung und tatsächlicher Leistung verhindert eine bedarfsgerechte Unterstützung zu Hause.
Verbale Zeugnisse zeigen kaum Wirkung
Die Studie deckt eine problematische Diskrepanz zwischen Intention und Wirkung verbaler Zeugnisinhalte auf. Verbale Lernstandsbeschreibungen, wie sie in den ersten Klassenstufen vieler Bundesländer verwendet werden, können die elterliche Fehleinschätzung kaum korrigieren. Noch problematischer: Sie führen teilweise sogar zu einer Reduktion elterlicher Aktivitäten mit den Kindern.
Der Grund liegt in der unterschiedlichen Interpretation geschriebener Bewertungen. Eltern verstehen die verbalen Formulierungen häufig nicht im Sinne der Lehrkräfte, wodurch wichtige Informationen über Förderbedarf verloren gehen.
Numerische Bewertungen steigern elterliches Engagement signifikant
Im deutlichen Kontrast dazu stehen die Auswirkungen numerischer Noten, Skalenbewertungen und persönlicher Gespräche mit Lehrkräften. Diese präziseren Informationsformate führen zu einer deutlichen Verhaltensänderung bei den Eltern.
„Väter und Mütter, die präzisere Informationen zum Leistungsstand erhielten, lasen häufiger mit ihren Kindern und spielten öfter mit ihnen, insbesondere, wenn es sich um das erste Zeugnis im Schulverlauf handelte“, fasst Ziege die Ergebnisse zusammen.
Bildungsgerechtigkeit durch bessere Information
Die Studienergebnisse haben besondere Relevanz für die Bildungsgerechtigkeit. Gut verständliche, strukturierte und frühzeitige Informationen über Schülerleistungen fördern elterliche Bildungsaktivitäten. Dies ist besonders für Kinder aus benachteiligten Haushalten ein wichtiger Hebel, damit alle Bildungspotenziale genutzt werden können.
„Gut informierte Eltern können besser unterstützen“, resümiert Elena Ziege. Gerade in Familien, in denen bereits eine Distanz zum Bildungssystem besteht, können klare, verständliche Rückmeldungen entscheidend dazu beitragen, dass Eltern ihre Kinder angemessen fördern.
Konsequenzen für die Schulpraxis
Die Forschungsergebnisse legen nahe, dass Schulen ihre Rückmeldepraktiken überdenken sollten. Statt ausschließlich auf verbale Beschreibungen zu setzen, spricht die Evidenz für eine stärkere Fokussierung auf numerische Bewertungen oder strukturierte Gespräche in den frühen Grundschuljahren.
Dies bedeutet nicht zwangsläufig eine Rückkehr zu traditionellen Notensystemen, sondern vielmehr die Entwicklung klarerer, verständlicherer Kommunikationsformen zwischen Schule und Elternhaus. Skalenbewertungen oder standardisierte Gesprächsformate könnten dabei Alternativen darstellen.
Die vollständige Studie „How information affects parents' beliefs and behavior: Evidence from first-time report cards for German school children“ ist hier verfügbar.